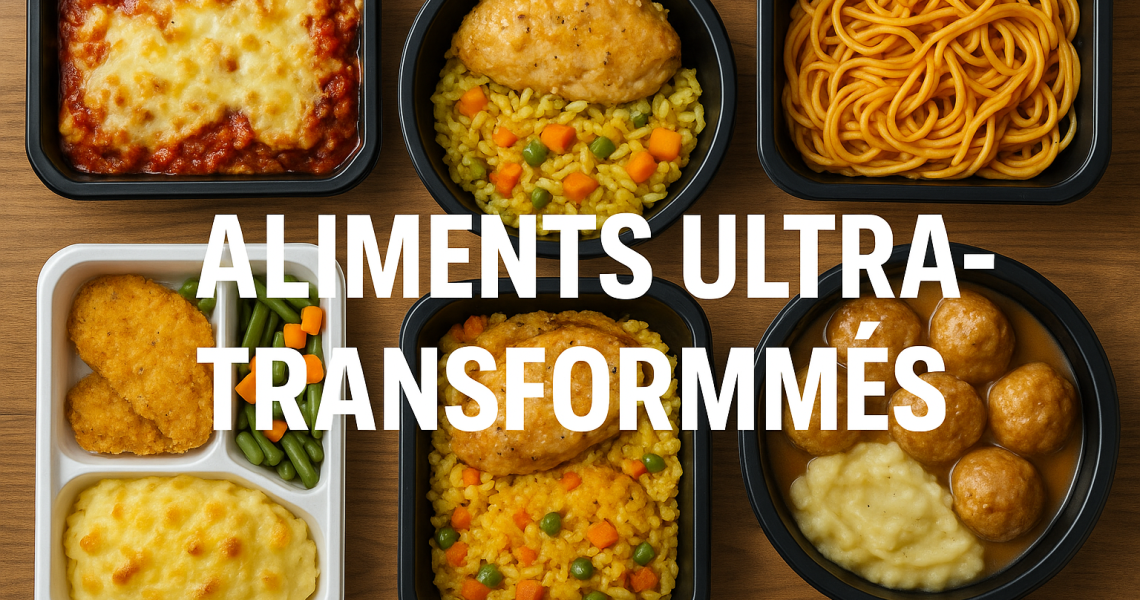Jeden Tag hören wir, dass „ultraverarbeitete Lebensmittel“ für unsere Probleme verantwortlich sind: Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes… Aber was ist, wenn diese Verteufelung zu einfach ist? Eine groß angelegte britische Studie hat kürzlich diese vorherrschende Sichtweise in Frage gestellt und gezeigt, dass es vielleicht nicht so sehr auf den Grad der Verarbeitung ankommt, sondern vielmehr auf unsere Wahrnehmung, unsere Überzeugungen und unsere Emotionen. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über :
- Was der Begriff „ultra-transformiert“ wirklich bedeutet
- Was die neueste Forschung nahelegt
- Warum unsere mentalen Vorstellungen schwerer wiegen können als die industrielle Klassifizierung
- Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheitspolitik
- Pragmatische Wege, um in unserem Alltag zu handeln
Was ist mein Ziel? Ihnen eine differenzierte, rigorose und umsetzbare Vision zu liefern – kein einfacher Slogan.
1. Was bedeutet „ultra-verarbeitete Lebensmittel“ wirklich?
Die NOVA-Klassifikation: nützlich, aber umstritten
Das NOVA-System, das häufig in der öffentlichen Ernährung verwendet wird, teilt Lebensmittel in vier Gruppen ein, je nach dem Grad der industriellen Verarbeitung. Die vierte Gruppe umfasst die „ultra-verarbeiteten“ Produkte: industrielle Produkte, die reich an Zusatzstoffen, Zucker, Aromen, Stabilisatoren usw. sind (zuckerhaltige Getränke, Schokoriegel, Fertiggerichte usw.).
Diese Kategorisierung hat jedoch ihre Grenzen:
- Sie mischt sehr unterschiedliche Produkte in einem Korb (z.B. zuckerhaltige Getränke, reformierte pflanzliche Ersatzstoffe);
- Sie berücksichtigt nicht die Variabilität der Ernährung innerhalb dieser Kategorie;
- Sie berücksichtigt nicht die sensorischen Reize, die kulturellen Gewohnheiten und den Kontext des Konsums.
| Lesen Sie auch: Lasertraining gegen Tabak und Sucht. Mylasertabac |
Warum diese Kategorie zum „Staatsfeind Nr. 1“ geworden ist
Seit mehreren Jahren werden in den Medien und in der Politik ultraverarbeitete Lebensmittel als Hauptursache für die Epidemie von Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar kognitiven Störungen angeführt. Das Ergebnis sind Warnhinweise, Werbebeschränkungen, Steuern, Verkaufsverbote in bestimmten Gebieten – alles auf der Grundlage der Annahme, dass „je verarbeiteter das Lebensmittel, desto schädlicher“.
Aber die Wissenschaft entwickelt sich weiter.
2. Neue Studie, neue Perspektiven: Was die britische Forschung zeigt
Ein Forscherteam untersuchte die Antworten von mehr als 3.000 britischen Erwachsenen, die mit 400 Lebensmitteln konfrontiert wurden, die auf Fotos abgebildet waren. Ihr Ziel war es, die „Wertschätzung“ von Lebensmitteln (was sie als angenehm empfinden) und ihre Neigung zu hedonischem Überkonsum (d.h. Konsum über das Sättigungsgefühl hinaus) zu messen.
Markante Ergebnisse
- Die NOVA-Klassifizierung erklärt nur 2% der Unterschiede in der Bewertung von Lebensmitteln und 4% des übermäßigen Verzehrs.
- Im Gegensatz dazu erklären wahrnehmungsbezogene Attribute (Geschmack, Textur, Fett, süß) und die Überzeugungen, die Menschen über ein Lebensmittel haben (z.B. „es ist industriell / natürlich / künstlich / gesund / kalorienreich“) einen viel größeren Anteil.
- Wenn ein Lebensmittel als „stark verarbeitet“ wahrgenommen wird, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es hemmungslos verzehrt wird, auch wenn seine tatsächliche Zusammensetzung dies nicht rechtfertigt.
- Durch die Kombination von Ernährungsdaten (41%) und Überzeugungen/Wahrnehmungen (37%) können die Forscher 78% der Veränderungen in der Neigung zum übermäßigen Verzehr vorhersagen.
Was wir daraus lernen
Die industrielle Klassifizierung allein (NOVA oder andere) reicht nicht aus, um zu erklären, warum wir manchmal „zu viel“ von einem Nahrungsmittel essen. Unsere mentalen Vorstellungen – was wir glauben, fühlen und erwarten – spielen eine entscheidende Rolle.

3. Warum unsere Überzeugungen oftmals die Klassifizierung überlagern
Die Macht der Darstellungen
Wenn ein Produkt als „ultra-verarbeitet“ gekennzeichnet wird, löst dies eine Kettenreaktion aus: Schuldzuweisungen, Urteile über „Junkfood“ und Gefahren. Selbst ein ernährungsphysiologisch gleichwertiges Produkt, das als „handwerklich“ oder „natürlich“ wahrgenommen wird, wird oft besser toleriert – oder sogar mit weniger Skrupeln übermäßig konsumiert.
Geschmack, Sättigung, Emotionen
Die gleichen Lebensmittel können je nach Umgebung, Marketing, Präsentation oder sogar Tageszeit unterschiedlich beurteilt werden. Emotionale Wünsche (Trost, Stress, Geselligkeit) beeinflussen unsere Wahl.
Darüber hinaus reicht es nicht immer aus, ein Produkt zu reformieren (Zucker, Fett, Salz zu reduzieren), sondern diese Reformulierung muss von einem Management des Geschmacks, der Sättigung und der sensomotorischen Erwartungen begleitet werden.

4. Was ist mit der aktuellen Ernährungspolitik?
Grenzen der „verbotenen / besteuerten / alarmierten“ Ansätze
- Sie können Nahrungsmittel verteufeln, die in einer ausgewogenen Ernährung durchaus ihren Platz haben können (z.B. angereicherte Cerealien, Proteinersatzprodukte).
- Sie können die breite Öffentlichkeit verwirren, indem sie widersprüchliche Signale geben (ein verarbeitetes Produkt, aber „gesunde Option“?).
- Sie behandeln nicht die psychologischen, sozialen und kulturellen Dimensionen der Essgewohnheiten.
Auf dem Weg zu einer intelligenteren und kontextualisierten Ernährung
Die Forscher schlagen drei Hauptachsen vor:
- Ernährungserziehung: Die Menschen sollen nicht nur lernen, Etiketten zu lesen, sondern auch ihre Hungersignale, ihre Gelüste und die Zusammenhänge des Konsums zu verstehen.
- Durchdachte Reformulierung: Entwerfen Sie Produkte, die sättigender und weniger übermäßig schmackhaft sind, ohne dabei das Geschmackserlebnis zu beeinträchtigen.
- Berücksichtigung der Ernährungsmotivation: Anerkennung, dass Essen auch ein emotionaler, sozialer und identitätsstiftender Akt ist – nicht nur ein physiologisches Bedürfnis.
5. Im Alltag: Wie können Sie handeln?
- Bevorzugen Sie wenig verarbeitete Lebensmittel, aber ohne übermäßiges Schuldgefühl: Ein verarbeitetes Produkt kann seinen Platz finden.
- Wahrnehmungsbewusstsein kultivieren: Hinterfragen Sie, wie Sie sich fühlen, wenn Sie „ultra-verwandelt“ sehen.
- Essen Sie in einem günstigen Kontext: ohne Stress, ohne Ablenkung, mit bewusster Mäßigung.
- Führen Sie Abwechslung, Texturen und hausgemachte Gerichte ein, wenn dies möglich ist.
- Hüten Sie sich vor „einfachen Diäten“ und der psychologischen Bestrafung, die manchmal mit Diätauflagen einhergeht.
Schlussfolgerung:
Unsere Beziehung zu Lebensmitteln ist komplexer als der einfache Gegensatz „verarbeitet/unverarbeitet“. Die britische Studie zeigt, dass unsere Überzeugungen, Empfindungen und mentalen Vorstellungen massiv in unser Verhalten eingreifen.
Für die öffentliche Politik und unsere täglichen Entscheidungen besteht die Herausforderung darin, von einer manichäischen Sichtweise zu einem nuancierteren Ansatz überzugehen, der auf Bildung, psychologischem Verständnis, intelligenten Reformen und Respekt vor dem Genuss beruht.